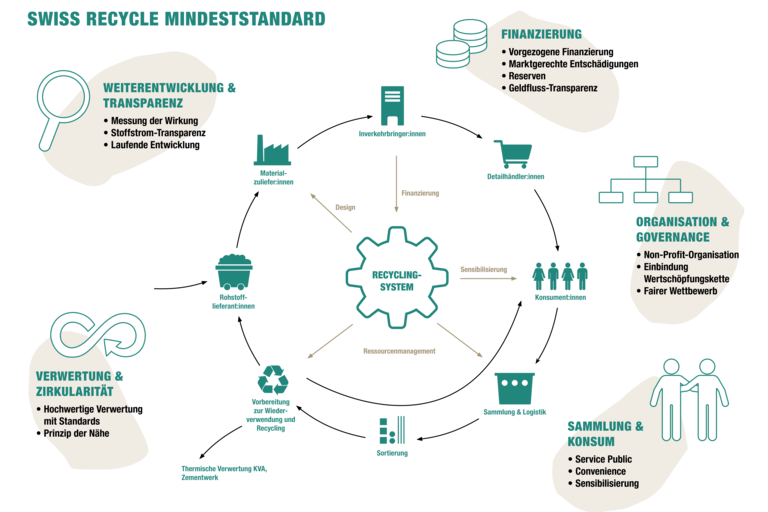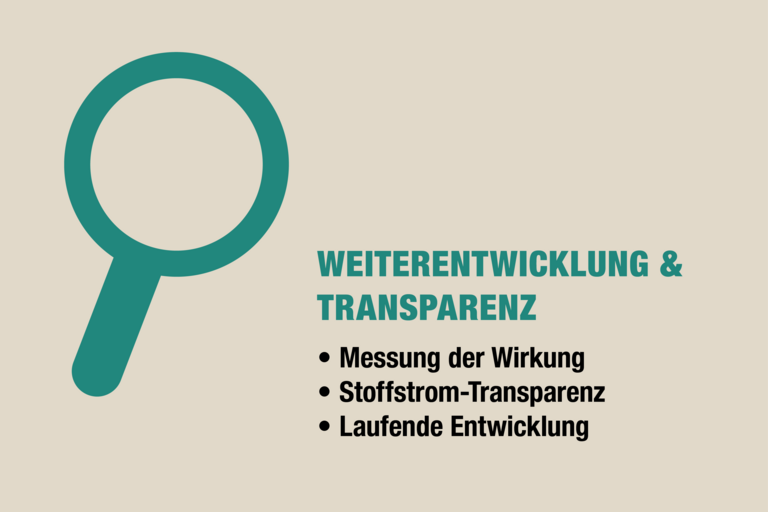Reserven
Reserven werden ausschliesslich zweckgebunden geäuffnet, um den dedizierten, statuarischen Zweck der Organisation zu erfüllen und dienen dazu Schwankungen bei den Einnahmen oder Ausgaben wie Entschädigungen aufzufangen, zukünftige Verbindlichkeiten zu decken und auch Sicherheiten bei einer allfälligen Auflösung eines Recycling-Systems zu gewähren. Reserven sind spezifisch je nach Art des Recycling-Systems (z.B. Rückgabe-Frequenz, Verträge mit Partnern, vorhandene Risiken) festzulegen.
Beispiel: Die Finanzierung für die spätere Sammlung, Transportierung, Sortierung und Verwertung erfolgt vorgezogen, die Ausgaben fallen jedoch erst Monate später an. Um die Mittel zweckgebunden verfügbar zu halten, werden Reserven gebildet. Die konkrete Höhe der Reserve orientiert sich an den Gegebenheiten des jeweiligen Systems und kann – wo gesetzlich geregelt – auch in Relation zu den Gebühren- oder Beitragserträgen definiert sein.
Transparenz und Revision Geldflüsse
Sämtliche Geldflüsse innerhalb des Recycling-Systems (Einnahmen aus vorgezogener Finanzierung, Ausgaben für Sammlung, Transport, Sortierung, Verwertung, Administration) müssen transparent und nachvollziehbar sein. Die Geldflüsse werden durch eine unabhängige Stelle (z.B. Revisionsgesellschaft) geprüft.
Beispiel: Offenlegung der Finanzen im Jahresbericht inkl. Revision